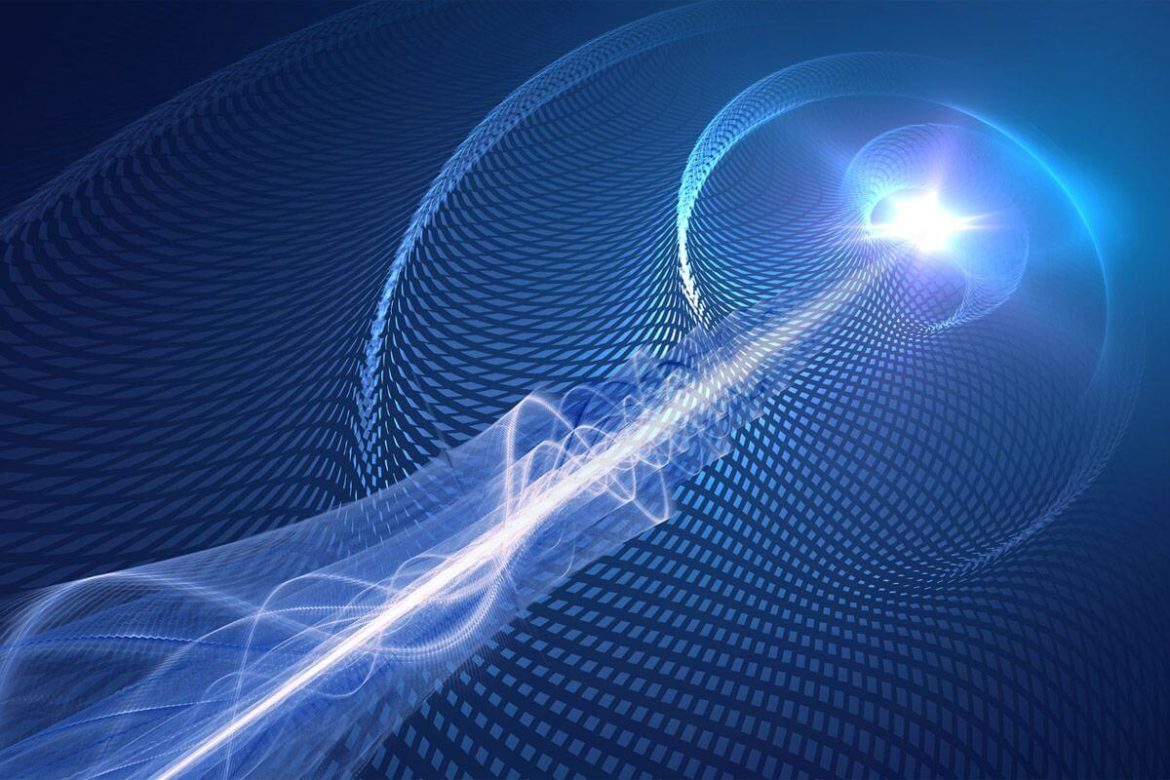Die Frage, ob wir allein im Universum sind, beschäftigt die Menschheit seit Jahrhunderten. Mit der Entdeckung tausender Exoplaneten und Fortschritten in der Astrobiologie rückt die Möglichkeit außerirdischen Lebens immer näher. Doch wo könnte intelligentes Leben tatsächlich existieren? Wissenschaftler haben einige vielversprechende Orte identifiziert.
Die Suche nach habitablen Zonen
Ein Schlüsselkonzept bei der Suche nach Leben ist die „habitable Zone“ – der Bereich um einen Stern, in dem flüssiges Wasser existieren kann. Wasser gilt als essentielle Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen. In unserem Sonnensystem liegt nur die Erde perfekt in dieser Zone, doch andere Sterne haben ähnliche Bedingungen.
Planeten wie Proxima Centauri b oder TRAPPIST-1e befinden sich in den habitablen Zonen ihrer Sterne. Obwohl ihre Umweltbedingungen extrem sein könnten – mit möglicherweise gebundener Rotation oder intensiver Strahlung – zeigen Simulationen, dass Leben dort nicht unmöglich ist.
Ozeane unter Eis: Monde als Lebensräume
Nicht nur Planeten, auch einige Monde in unserem Sonnensystem gelten als Kandidaten für außerirdisches Leben. Der Jupitermond Europa und der Saturnmond Enceladus besitzen unter ihrer Eiskruste riesige flüssige Ozeane. Geysire auf Enceladus speien Wasser und organische Moleküle ins All, was auf hydrothermale Aktivität hindeutet.